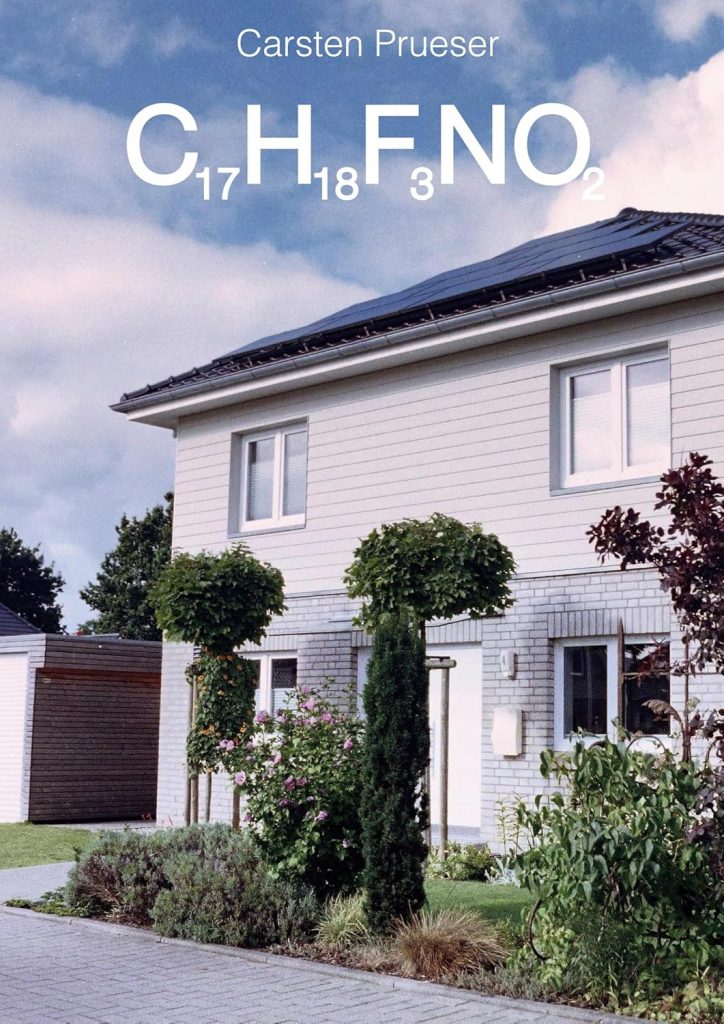Warum Barthes heute radikaler ist als seine Interpreten – und warum seine Begriffe eine Waffe gegen die identitäre und algorithmische Erschöpfung der Fotografie bleiben.
Es gehört zu den Ironien der Kulturtheorie, dass ausgerechnet Roland Barthes’ Begriffe studium und punctum – gedacht als poetische Miniaturen eines individuellen Blicks – zu einer Art akademischem Plastiksatz erstarrten. Man begegnet ihnen inzwischen wie man Layer in Photoshop begegnet: als verschiebbare Bausteine, mit denen sich jedes Bild problemlos erklären lässt. Genau dies wäre Barthes’ Horror gewesen. Die helle Kammer ist nicht Theorie im strengen Sinn, sondern eine Trauerprosa, eine Meditation über die Übermacht der Bilder und ein Versuch, in dieser Übermacht noch ein Stück unverfügbarer Subjektivität zu behaupten.
Gerade deshalb verdient der Text eine Relektüre, die ihn aus dem akademischen Formalin befreit.
Das studium: die nivellierende Ordnung der Sichtbarkeit
Barthes’ studium bezeichnet das kulturell Erlernbare – die soziale Grammatik eines Bildes. In der Gegenwart ist dieses studium jedoch nicht mehr kulturell, sondern technisch codiert. Es wird nicht von Kunstgeschichte oder bürgerlicher Bildung geformt, sondern von Plattform-Ökonomien, von Recommendation Engines, visuellen Normierungsmechanismen, dem kapitalistischen Imperativ der Konformität.
Das studium der Gegenwart ist algorithmischer Konsens.
Das Bild wird nicht mehr Ausdruck oder Spur, sondern Produkt einer industriellen Affektökonomie. Die verwaltete Sichtbarkeit erlaubt nur zwei Modi: das Gefällige und das Empörende. Dazwischen verschwindet die Welt.
Das studium ist damit die perfekte Kategorie unserer Epoche: der Raum, in dem jedes Bild identisch wird mit den Erwartungen der Plattformen, der Milieus, der identitären Szenen.
Das punctum: der Riss, der nicht verwaltet werden kann
Das punctum ist der prekäre Moment, in dem ein Bild aus dieser Ordnung herausfällt. Barthes nennt es den „Stich“ – ein Detail, das den Betrachter aus dem Gleichgewicht bringt, ohne erklärbar zu sein.
Das punctum ist ein Ereignis der Nicht-Identität: ein kleiner Aufstand gegen die totalisierte Kultur der Lesbarkeit. Es ist ein Affekt ohne Algorithmus, eine Form, die sich nicht kapitalisieren lässt.
In einer Welt, die jeden Blick ökonomisiert, ist das punctum der winzige Rest Freiheit, den die Bilderindustrie nicht einfängt.
Gegen die identitäre Erschöpfung des Blicks
Die identitäre Linke wie die identitäre Rechte – ideologische Antipoden, ästhetische Zwillinge – haben die Fotografie längst in eine Bühne des Gruppenperformens verwandelt. Bilder dienen nicht mehr der Begegnung mit Wirklichkeit, sondern der Bestätigung von Rollen: Opfer, Täter, Aktivist, Held, Zeuge.
Das studium ist hier der normative Raum der identitären Ästhetik: Sag, was du bist. Zeig, zu wem du gehörst.
Das punctum verweigert diese Logik. Es entzieht sich dem Kollektivismus und öffnet einen gefährlich offenen Raum des Subjekts. Damit ist das punctum überraschend kompatibel mit dem humanistisch-progressiven Ethos der Frankfurter Nachrichten: dem Beharren auf Freiheit, Nicht-Identität, individueller Erfahrung.
Fotografie als Widerstandspraxis
Für eine fotografische Praxis heute – journalistisch, dokumentarisch oder künstlerisch – bedeutet das:
- Das studium ist unvermeidlich: Jede Aufnahme trägt Codes, Oberflächen, Erwartungen.
- Das punctum jedoch muss ermöglicht werden: durch Kontingenz, durch Zeit, durch Unberechenbarkeit.
Das punctum entsteht dort, wo die Fotografie sich weigert, eine Funktion zu erfüllen. Dort, wo sie nicht illustriert, nicht moralisiert, nicht performt.
Jenseits von Barthes: punctum im vernetzten Zeitalter
Eine Theorie der Fotografie im 21. Jahrhundert müsste Barthes nicht ersetzen, sondern radikalisieren. Das punctum ist heute weniger ein Detail im Bild als eine Störung im Informationsfluss: ein Moment, in dem die Logik der Sichtbarkeit aussetzt.
Das punctum ist die letzte unverwaltete Zone im Bild – und vielleicht die letzte unverwaltete Zone im Subjekt.
Barthes’ Begriffe sind nicht nostalgisch, nicht sentimental, nicht „schön“. Sie sind politisch – gerade weil sie das Politische nicht direkt adressieren.
Im Zeitalter der algorithmischen Sichtbarkeit ist das studium die Ordnung der Macht. Das punctum ist ihre Unterbrechung.
Und genau dort beginnt – immer noch, und vielleicht dringlicher denn je – die Freiheit der Fotografie.