Die Frankfurter Stelle für Informationsfreiheit (FSIF) will das Schweigen der Behörden brechen
Frankfurt hat ein Transparenzproblem. Bürger, Journalisten, Aktivisten, selbst Stadtverordnete stoßen regelmäßig auf Mauern, wenn sie von Ämtern Informationen verlangen, die eigentlich öffentlich sein sollten. Das Informationsfreiheitsgesetz in Hessen – das HDSIG – existiert auf dem Papier, aber kaum in der Verwaltungspraxis. Hier setzt die Frankfurter Stelle für Informationsfreiheit (FSIF) an.
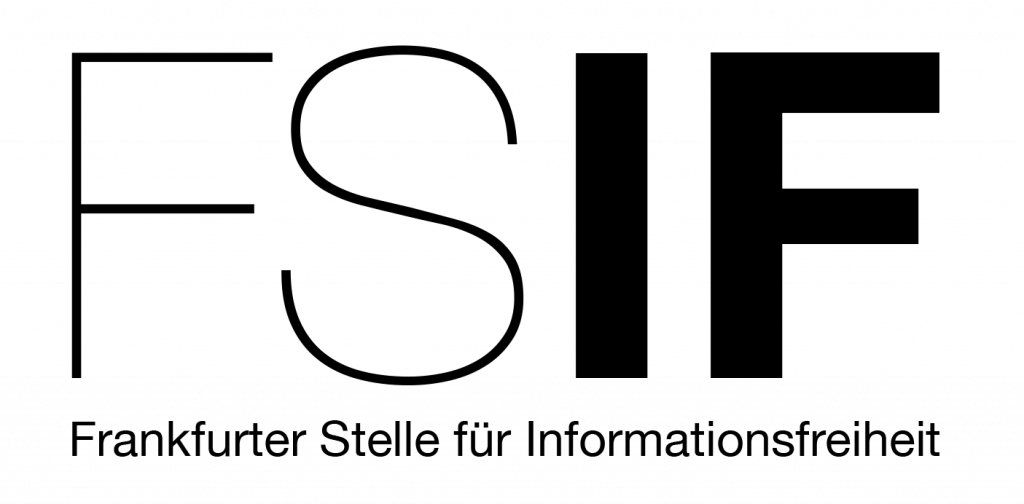
Die FSIF versteht sich als zivilgesellschaftliche Einrichtung, die Informationsfreiheit nicht als behördlichen Gnadenakt, sondern als Grundrecht in Vollzug begreift. Sie sieht in der Offenlegung amtlicher Informationen nicht die Ausnahme, sondern die Regel – und fordert damit, was in vielen europäischen Städten längst selbstverständlich ist: Transparenz als Standard.
Gegen die Kultur der Intransparenz
In Frankfurt herrscht, trotz aller Digitalisierungsrhetorik, eine erstaunliche Kultur des Verschweigens. Protokolle werden zurückgehalten, Gutachten verschwinden in Aktenordnern, und Presseanfragen verlaufen im Sand. Das Muster ist bekannt: Man erklärt sich für „nicht zuständig“, verweist auf „laufende Verfahren“ oder „Datenschutz“. Am Ende steht: nichts.
Die FSIF dokumentiert diese systematischen Formen der Informationsverweigerung, prüft die Rechtslage und unterstützt Betroffene bei Anträgen nach dem Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz. In Einzelfällen begleitet sie auch rechtliche Schritte, wenn Behörden ihren gesetzlichen Pflichten nicht nachkommen.
Transparenz als demokratische Infrastruktur
Hinter der Initiative steht die Überzeugung, dass Demokratie nicht nur durch Wahlen, sondern durch Wissen und Kontrolle lebt. Informationsfreiheit ist das Werkzeug, mit dem Bürger die Funktionsweise ihrer Institutionen nachvollziehen können. Sie ist kein „Nice-to-have“, sondern eine Voraussetzung politischer Mündigkeit.
„Ohne Akteneinsicht keine Aufklärung, ohne Aufklärung keine Verantwortung“, heißt es bei der FSIF. Das Ziel ist ein Paradigmenwechsel: weg von der Aktenversessenheit, hin zu einer Verwaltung, die sich von sich aus öffnet – in Echtzeit, digital, nachvollziehbar.
Eine Gegenöffentlichkeit aus Frankfurt
Die FSIF ist unabhängig, parteilos und journalistisch verbunden mit den Frankfurter Nachrichten, die regelmäßig über Missstände im Bereich Transparenz und Verwaltung berichtet. Gemeinsam bilden sie ein Labor für neue Formen demokratischer Öffentlichkeit: juristisch präzise, lokal verankert, kritisch im Denken.
Frankfurt könnte, wenn es wollte, ein Vorbild werden – eine Stadt, die ihre Bürger als Partner begreift und Information als öffentliches Gut behandelt. Noch ist sie es nicht. Aber die FSIF zeigt, dass es Menschen gibt, die das ändern wollen.
Neue Serie
In loser Folge werden die Frankfurter Nachrichten zukünftig von der Arbeit der FSIF berichten. Wir werden Beispielsfälle für Intransparenz und Vertuschung dokumentieren.

