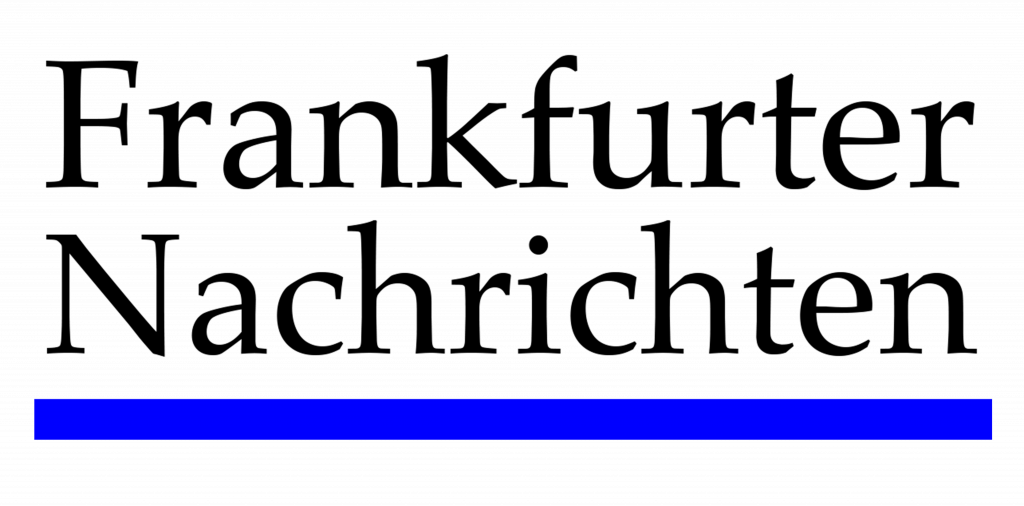Über die strukturelle Nähe zwischen den alten autoritären Utopien und den neuen identitätspolitischen Konformismen.
Die neue Orthodoxie
Es gibt Phänomene, die mit dem Anspruch auftreten, die Welt gerechter zu machen – und gerade dadurch beginnen, sie enger zu ziehen. Die Identitätspolitik ist ein solches Phänomen. Sie spricht im Namen der Achtsamkeit, der Sensibilität, der historischen Verantwortung. Sie verspricht, Marginalisierung sichtbar zu machen und strukturelle Ungerechtigkeiten aufzubrechen. Doch die Art, wie sie Politik denkt, folgt einer Logik, die nicht befreit, sondern einhegt: Menschen werden nicht als Subjekte ernst genommen, sondern als Träger von Kategorien; nicht als Verantwortliche, sondern als Repräsentanten. Dieses Denken wirkt wie eine neue Orthodoxie – eine, die nicht durch Autorität, sondern durch moralische Überhöhung operiert.
Der historische Bruch: Als der Universalismus verschwand
Um zu verstehen, warum diese Orthodoxie entstehen konnte, muss man den Ort betrachten, an dem sie sich gebildet hat: die intellektuelle Leerstelle nach 1989. Mit dem Zusammenbruch des Ostblocks verlor die Linke ihren universalistischen Orientierungspunkt. Die Idee eines gemeinsamen Subjekts – einst der Arbeiterklasse zugeschrieben – löste sich auf. Die historische Erzählung, dass Emanzipation ein kollektives Projekt sei, schien erschöpft. In diese Leere drangen neue Achsen politischer Selbstbeschreibung: Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe, Sexualität. Was vorher eine Frage gesellschaftlicher Strukturen war, wurde zunehmend zu einer Frage persönlicher Identitäten. Es war der Übergang von einer Politik der Transformation zu einer Politik der Sichtbarkeit – und mit ihm ging etwas verloren: der Anspruch, für alle zu sprechen.

Die Logik der Identität: Fixierung statt Freiheit
Identitätspolitik arbeitet mit Kategorien, die Menschen zugeordnet werden. Nicht Handlungen definieren das Politische, sondern vermeintlich unverrückbare Merkmale. In dieser Verschiebung geht etwas Grundsätzliches verloren: die Freiheit des Individuums, sich zu überschreiten. Identitätspolitik beschreibt nicht nur die Welt, sie teilt sie ein – und zwar entlang moralischer und sozialer Grenzziehungen. Aus dieser Einteilung erwächst eine politische Theorie, die Subjektivität nur noch als Ausdruck vorgegebener Zugehörigkeiten versteht. Das Ergebnis ist keine Öffnung, sondern eine Verengung. Sie verspricht Sensibilität, aber sie verordnet Rollentreue; sie fordert Respekt, aber sie erzeugt Deutungshoheit; sie spricht im Namen der Vielfalt, aber sie arbeitet mit starren Rasterungen.
Strukturelle Nähe: Identitätspolitik und Marxismus-Leninismus
Die Ähnlichkeit zwischen Identitätspolitik und Marxismus-Leninismus liegt nicht in ihren Zielen, sondern in ihrer Denkarchitektur. Beide Systeme beruhen auf einer starken Vereinfachung der Welt. Sie teilen die Gesellschaft in moralisch bewertete Kollektive: damals Proletariat und Bourgeoisie, heute Unterdrückte und Privilegierte. In beiden Fällen entsteht eine politische Moral, in der Abweichung nicht als Argument zählt, sondern als Verfehlung. Die Fixierung auf die „richtige Identität“ – früher Klassenidentität, heute Gruppenidentität – schafft eine Welt, in der politische Legitimität nicht aus Vernunft, sondern aus Zugehörigkeit erwächst. Auch die Feindbildlogik ist verwandt: Revisionisten dort, „problematische Stimmen“ hier. Vor allem aber teilen beide Systeme ein tiefes Misstrauen gegenüber Ambiguität. Das Hybride, das Dazwischen, das nicht Identifizierbare gilt stets als Gefahr. Der Inhalt hat sich geändert – die Denkform kaum.
Die neue Linke als kulturpolitische Avantgarde des kulturell entgrenzten, finanzialisierten Kapitalismus
Dass die Identitätspolitik so hegemonial werden konnte, hat auch mit der ökonomischen Ordnung zu tun, in der sie auftritt. Der zeitgenössische Kapitalismus hat ein hohes Talent zur Integration von Differenz. (Lesenswert dazu: Von Diversitäts-Feenstaub und der großen Umarmung des Kapitals) Alles, was als kulturelle Forderung erscheint, lässt sich einarbeiten – solange die Eigentumsordnung unangetastet bleibt. So konnte die Identitätspolitik zu einer Art kulturpolitischer Begleitmusik eines Systems werden, das reale Ungleichheiten vergrößert, während es zugleich symbolische Kämpfe befördert. Sie verschiebt Konflikte von der materiellen auf die moralische Ebene, ersetzt strukturelle Kritik durch subjektive Positionierung und zerlegt Probleme in Einzelperspektiven, die eigentlich gemeinsam adressiert werden müssten. In dem Maße, in dem sie Sichtbarkeit fordert, verliert sie die Fähigkeit, gesellschaftliche Verhältnisse zu analysieren. Sichtbarkeit beschreibt, wer betroffen ist – nicht jedoch, warum bestimmte Gruppen strukturell benachteiligt werden. Je stärker Politik auf Repräsentation, Anerkennung und subjektive Erfahrung fokussiert, desto weniger richtet sie den Blick auf die tieferliegenden Kräfte, die Ungleichheit hervorbringen: institutionelle Mechanismen, ökonomische Interessen, Machtkonzentrationen und die Logiken des finanzialisierten Kapitalismus. Gerade darin liegt die eigentliche Problematik: Sichtbarkeitspolitik operiert an der Oberfläche, während die wirkmächtigen Strukturen darunter unangetastet bleiben. Dass Identitätspolitik sich so reibungslos in einen kulturell entgrenzten, finanzialisierten Kapitalismus einfügt, ist daher kein Zufall, sondern Ausdruck einer strukturellen Kompatibilität.
Warum diese Politik die Freiheit beschädigt
Moderne Freiheit lebt von der Möglichkeit, sich nicht festlegen zu lassen. Von der Fähigkeit, Grenzen zu überschreiten, Rollen zu verbinden, verschiedene Lebenssphären miteinander zu verknüpfen. Identitätspolitik widerspricht dieser Freiheit im Kern. Sie normiert Sprache, indem moralische Bewertung das Argument ersetzt; sie reduziert Subjektivität, indem Menschen zu Repräsentanten ihrer Zuschreibungen erklärt werden; sie bekämpft Uneindeutigkeit, als wäre sie ein politischer Makel; sie eskaliert Debatten moralisch, statt sie argumentativ zu führen. Besonders deutlich wird ihre Begrenztheit dort, wo gesellschaftliche Rollen und Erwartungen ineinandergreifen: etwa wenn Menschen über institutionelle, kulturelle oder berufliche Sphären hinweg agieren und damit gängige Zuordnungen irritieren – oder wenn Personen, die gesellschaftlich als Angehörige benachteiligter Gruppen gelten, machtvolle Positionen einnehmen, die nicht ins gängige Raster passen. Identitätspolitik kann diese Formen von Transversalität kaum erfassen. Sie verlangt Eindeutigkeit, wo soziale Wirklichkeit komplex und vielstimmig ist.
Institutionen, die Eindeutigkeit benötigen, reagieren allergisch auf solche Subjekte. Identitätspolitik tut genau dasselbe – nur mit moralischem Nachdruck. Die autoritäre Struktur ist dieselbe: Sie will Ordnung, nicht Freiheit.
Der freiheitliche Gegenentwurf: Humanistischer Progressivismus
Eine zeitgemäße linke Politik braucht eine Rückkehr zu den Grundbegriffen, die sie einst auszeichneten: universelle Freiheit, kritische Vernunft, die Fähigkeit, gesellschaftliche Widersprüche auszuhalten, ohne sie in identitäre Lager einzuteilen. Sie muss das Subjekt wieder in den Mittelpunkt stellen – nicht als Träger von Merkmalen, sondern als handelndes Wesen. Kritik muss wieder Vorrang gegenüber moralischer Anrufung bekommen; Pluralität muss als produktive Spannung begriffen werden, nicht als Gefahr; und Universalität muss die Grundlage politischer Normsetzung bleiben. Eine Politik, die nur für ihre Teilgruppen spricht, hat die Idee des Gemeinsamen bereits aufgegeben. Eine Politik, die Freiheit verteidigen will, muss sie neu begründen.
Schluss: Die Rückkehr zur Aufklärung
Identitätspolitik ist die Reaktion auf einen historischen Verlust – den Wegfall eines gemeinsamen politischen Horizonts. Doch sie ist nicht der Weg nach vorn. Sie ersetzt Freiheit durch Zugehörigkeit, Kritik durch Moral, Pluralität durch Segmentierung. Sie produziert neue Grenzen, wo sie alte einreißen wollte. Die Zukunft des Politischen wird nicht in neuen Identitäten liegen, sondern in der Fähigkeit, die Idee des Allgemeinen zurückzugewinnen.
Nicht Identität, sondern Nicht-Identität. Nicht Stamm, sondern Subjekt. Nicht Reinheit, sondern Freiheit. Nicht moralische Verdichtung, sondern demokratische Kritik.
Nur so kann die Linke aus ihrer selbstgebauten Engführung ausbrechen – und wieder das werden, was sie einmal war: eine Stimme der Emanzipation.