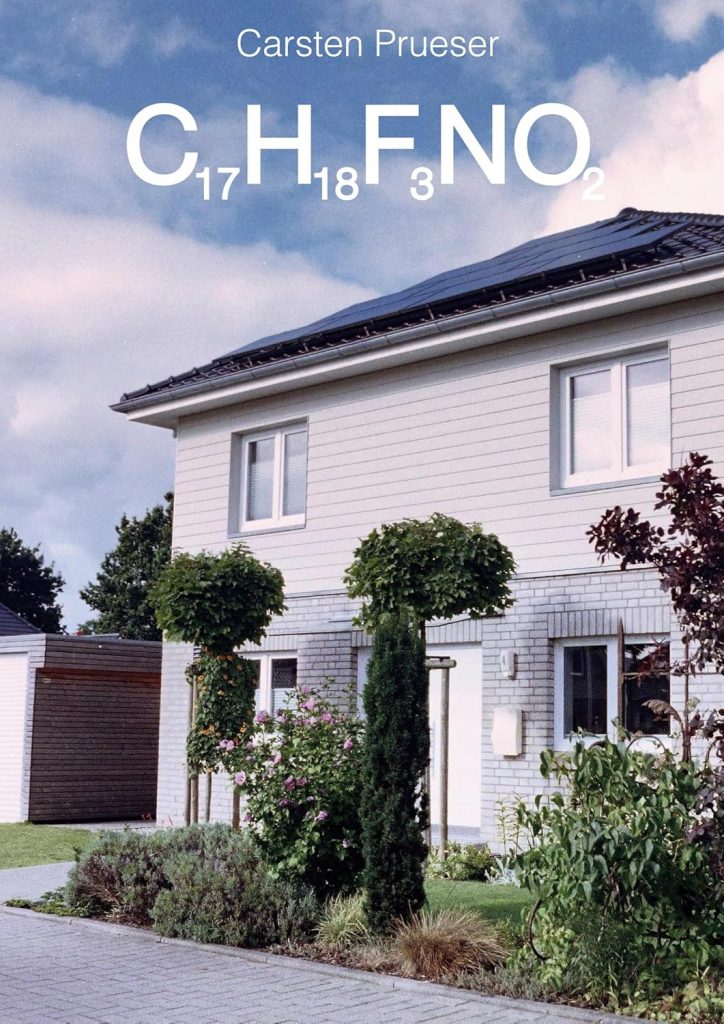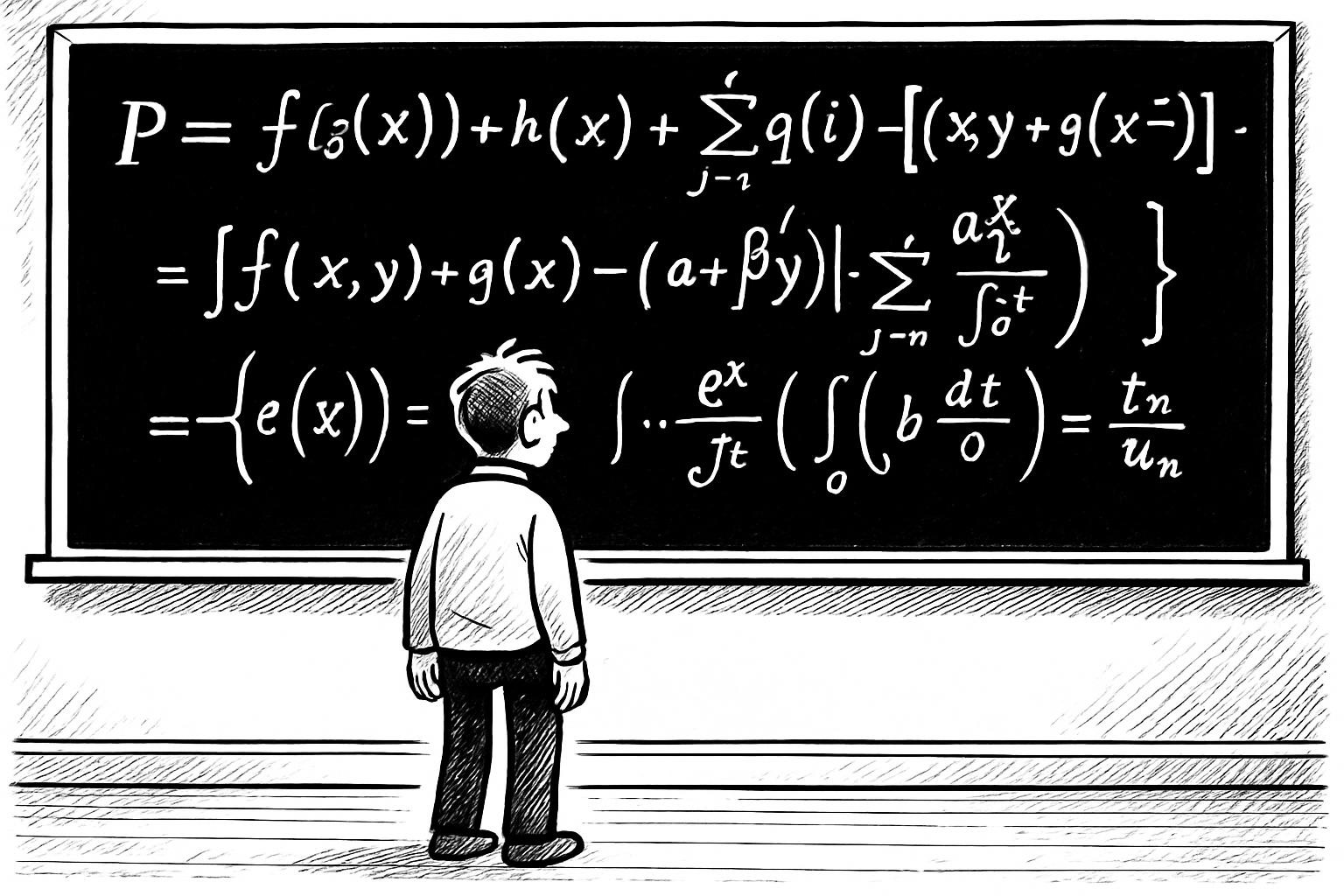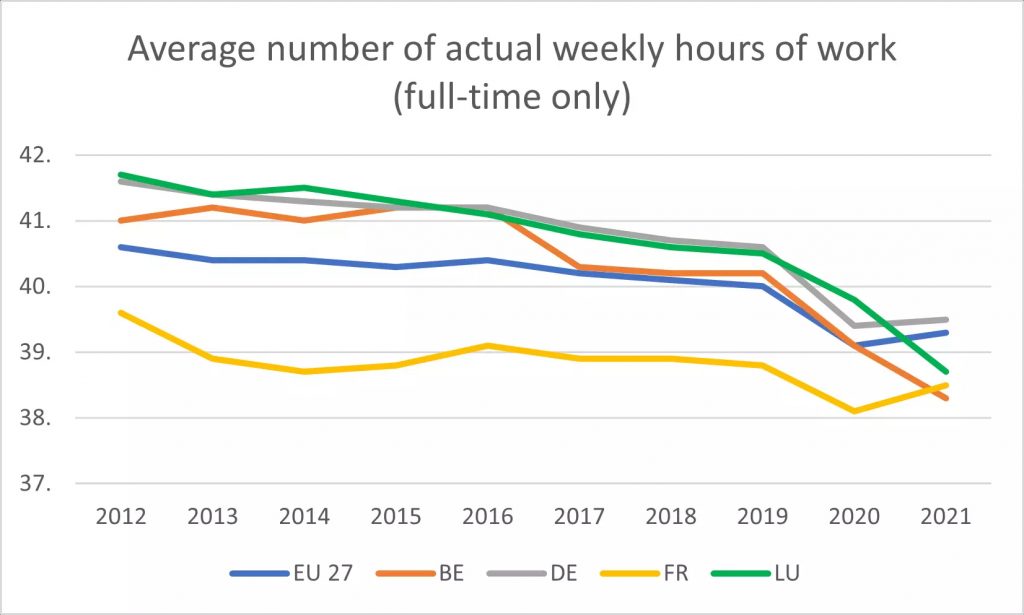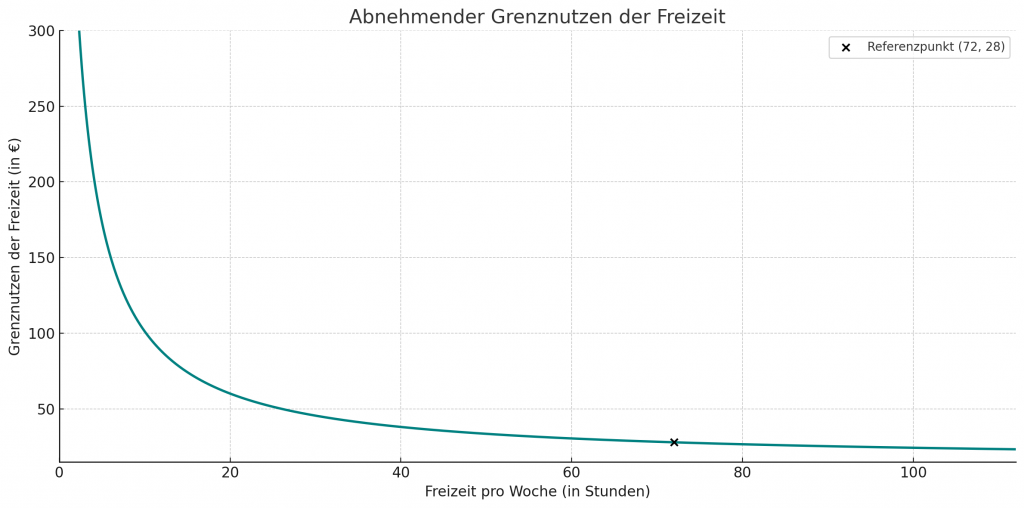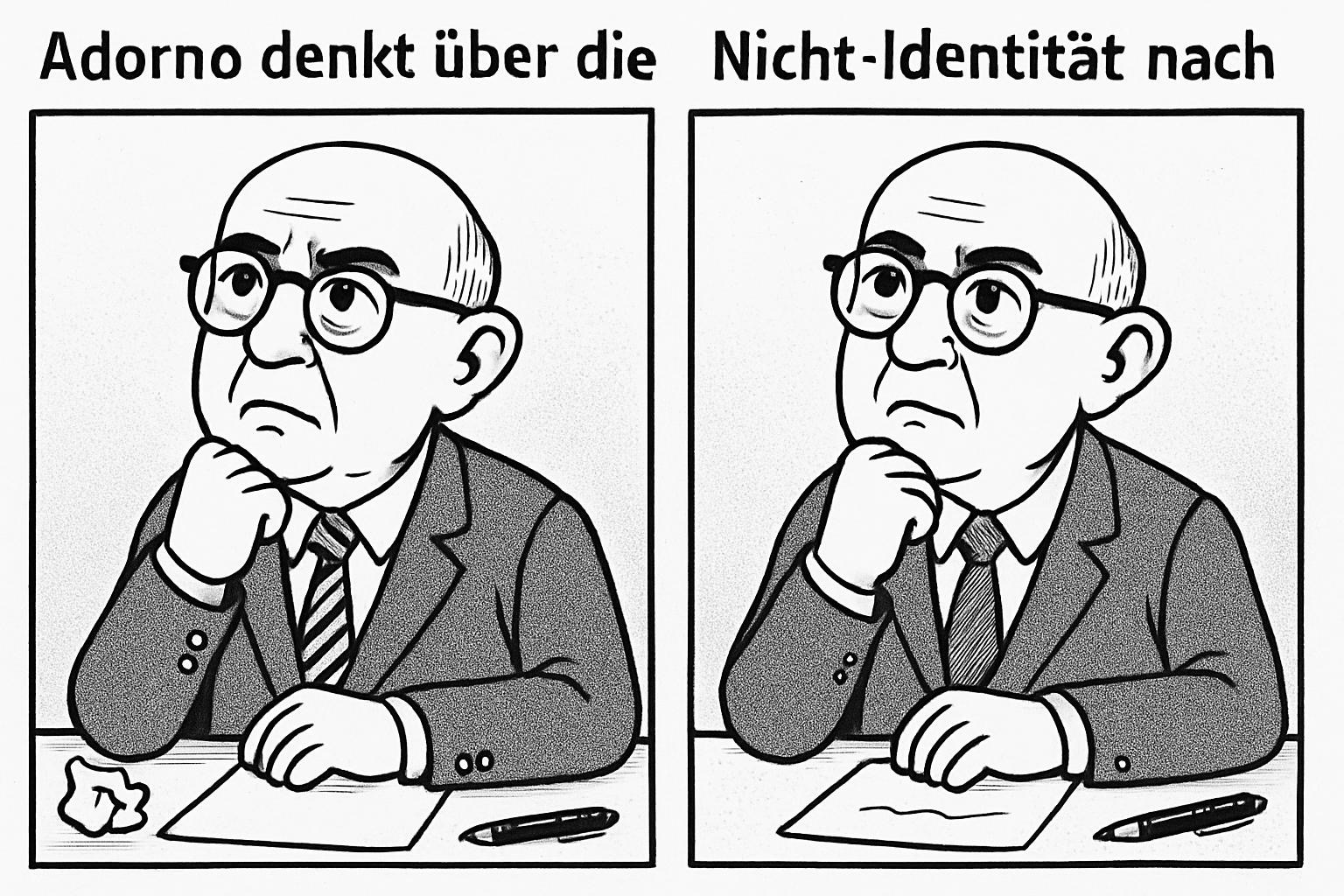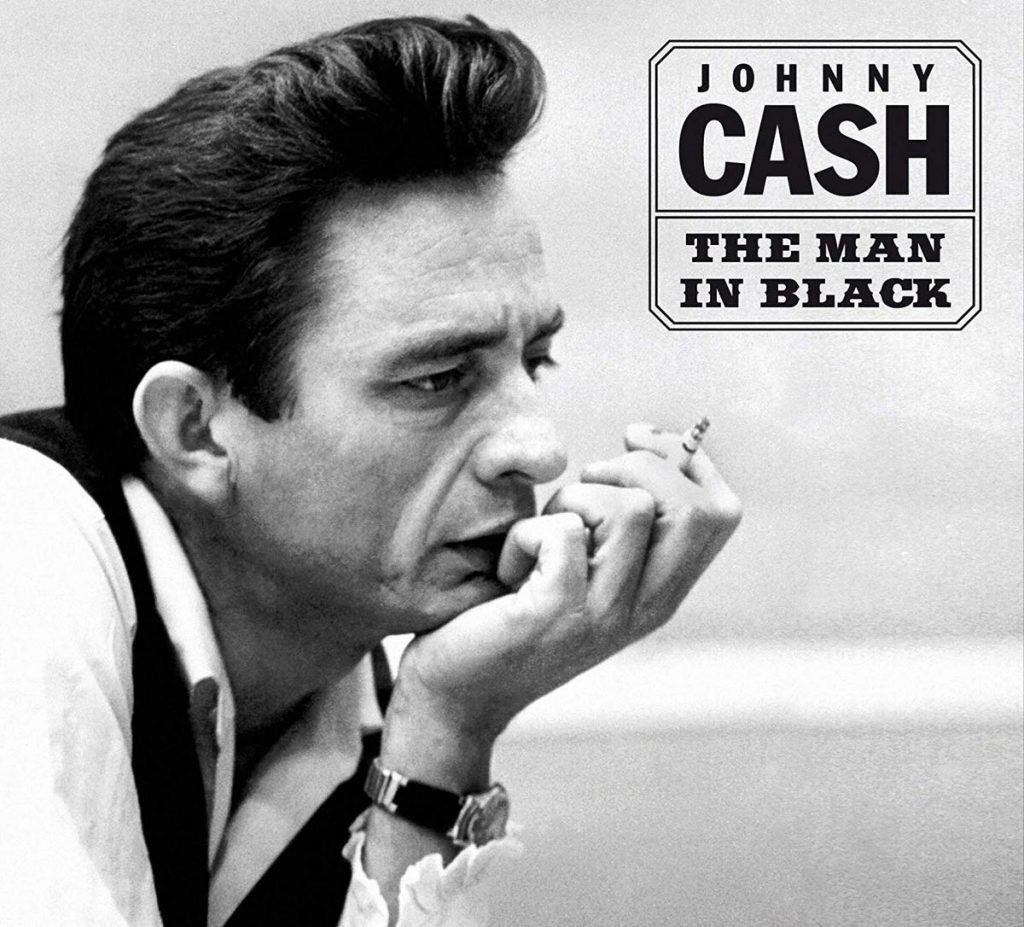Das Alter ist kein bloßes biografisches Detail, sondern ein Resonanzraum. Wer als ergrauter Besucher zwischen die Jüngeren und die Gleichaltrigen tritt, begegnet nicht nur der Musik, sondern auch sich selbst – den verpassten Aufständen, den überstandenen Illusionen, den Restbeständen an Utopie. In diesem Spannungsfeld lagen zwei Abende, die sich kürzlich boten: Patti Smith, die Priesterin des Aufbegehrens, am 18. Oktober 2023 im ausverkauften Zoom in Frankfurt. Und „etwas“ später BAP, Chronisten kölscher Alltagswiderständigkeit, am 15. August 2025 im Amphitheater Hanau, vor gut gefüllten Rängen beim vorletzten Halt ihrer Zeitreise-Tour.
Patti Smith betritt die Bühne des Zoom in Frankfurt, und plötzlich ist der Raum kein Club mehr, sondern ein Ort der Möglichkeit. Man spürt, dass hier etwas geschieht, das nicht völlig planbar ist. Ihre Stimme bricht und erhebt sich zugleich, ihre Gesten sind ungelenk und heilig, ihre Worte – mal rezitiert, mal geschrien – erinnern daran, dass Kunst mehr sein kann als Unterhaltung. Smith verkörpert den Ernst einer Generation, die gelernt hat, dass Schönheit im Bruch liegt. Ihre Lieder sind Fragmente eines offenen Prozesses: nichts Abgeschlossenes, nichts Fertiges. Hier wird nicht Nostalgie verwaltet, sondern Gegenwart erkämpft. Auffällig: Neben den lebensbegleitenden Fans ziehen ihre Konzerte auch jede Menge junge Leute an, die überraschend selbstverständlich Zugang zu ihrer Kunst finden.

Patty Smith im Frankfurter Zoom. Foto: Anton Vester
Bei Wolfgang Niedecken und BAP, ein ganze Zeit später im Amphitheater Hanau, herrscht ein anderer Ton. Es ist Sommerabend, die Luft riecht nach Bier und Bratwurst, und die Bühne gleicht einem gut eingespielten Ritual. Niedecken spricht, singt, erzählt, wie er es seit Jahrzehnten tut. Die Fans nicken, mitsingen ist Pflicht, der kollektive Schulterschluss programmiert. Man könnte sagen: alles in Ordnung. Aber eben auch: alles schon gehört. Rebellion ist hier zur Folklore erstarrt, Sozialkritik zum Soundtrack der Stammtische mit Wohlgefühlgarantie. Hinterher werdet Ihr Euch vierzig Jahre jünger fühlen, verspricht der Entertainer.
Tatsächlich: Im Publikum finden sich fast ausschließlich Zuhörerinnen und Zuhörer 50+, für die BAP längst zur eigenen Biografie gehört. Und doch ist dieses Publikum gezeichnet von den Deformierungen durch ein Leben mit Entfremdung, Herrschaft und Verdinglichung.
Erst nach reichlichem Bierkonsum und wenn die Musik gegen Ende die Emotionen durch Tempo und Greatest-Hit-Eigenschaft befeuert, tritt bei einigen ein schwaches Leuchten in die müden Augen, ein vorsichtiges Erinnern, dass man ein anderes Leben wollte. Für sich und für Carmen, Alexandra, den Jupp und auch für den Müsliman. In der Südstadt, auf der Insel und in der ganzen Welt. Aber es ist irgendwie anders gekommen. Nicht nur am 10. Juni, sondern das ganze Leben.
Die kritische Theorie spricht von „Verwaltung“: sobald das Widerspenstige sich in Routinen verwandelt, verliert es seinen Stachel. Was bei Patti Smith noch wie ein unberechenbarer Aufbruch wirkt, erscheint bei BAP als kulturelle Betriebsamkeit, die niemandem mehr wehtut. Niedecken singt über Ungerechtigkeit, aber stets so, dass das Publikum zustimmen kann, ohne sich selbst zu hinterfragen. Dabei bleibt er die Antwort schuldig, was denn nun richtig sei:
»Bliev do, wo de bess / halt dich irjendwo fess / un bliev su, wie de woors / jraad’uss« (Jrad’uss) oder die rezitierte Sentenz »Nur wer sich ändert, bleibt sich selbst treu« (Wolf Biermann). Smith dagegen fordert – mit brüchiger Stimme, mit literarischer Härte – dass man sich einmischt, auch wenn es unbequem ist.
„The people have the power / to wrestle the world from fools.“

Foto: Tina Niedecken
Die Dialektik dieses Konzertdoppels: Musik kann zugleich Betäubung und Aufweckruf sein. In Hanau wird das Kollektiv in Sicherheit gewogen, im Zoom in Frankfurt wird es auf See hinausgeschickt. Die eine Bühne produziert Zugehörigkeit, die andere Unsicherheit. Beides ist menschlich, doch nur eines bewahrt die Kunst davor, zur bloßen Ware zu werden. Und es passt genau, dass Niedecken Ware, aka „Merch“, reichlich dabei hat. Sein gesprochener Werbeblock für das Fanzine zur Tournee irritierte nur kurz, war ja nur eine „Verbraucherinformation“.
So bleibt der Eindruck: BAP, das ist die Kölner Bucht – vertraut, berechenbar, ein Heimathafen. Patti Smith, das ist die Lower East Side oder heute eher Red Hook – rau, widersprüchlich, ein Ort, an dem man sich verliert, um sich vielleicht neu zu finden. Die Frage ist, was man sucht: das Bekannte oder die Wahrheit.
Wer letzteres wollte, kam an diesem Abend im Zoom in Frankfurt näher an die Wahrheit – und zugleich näher an sich selbst.