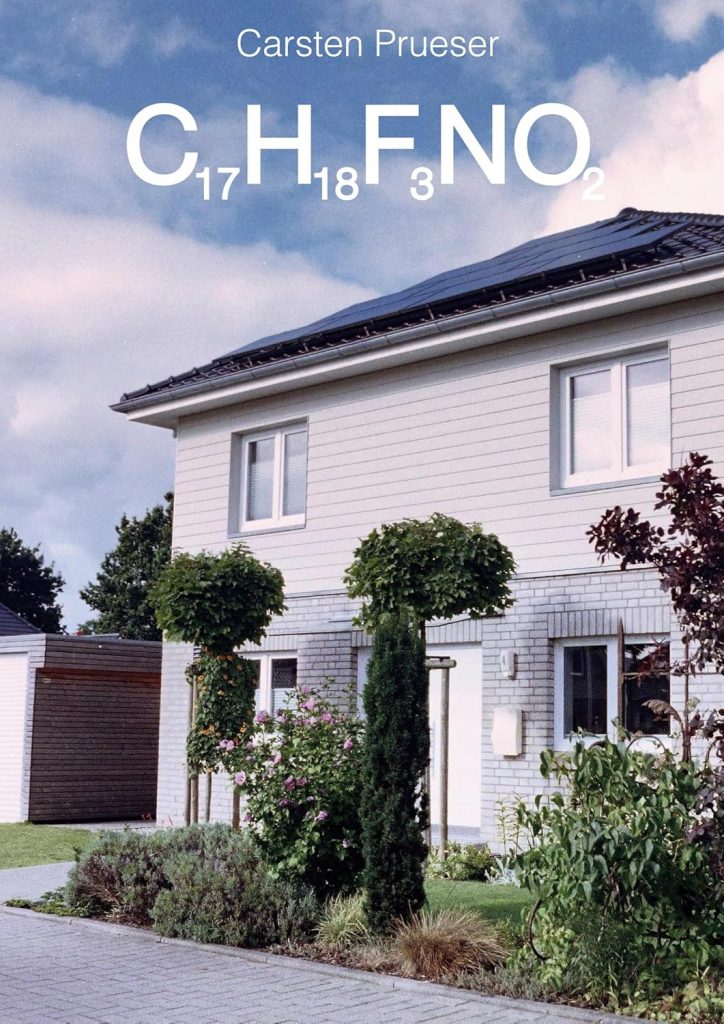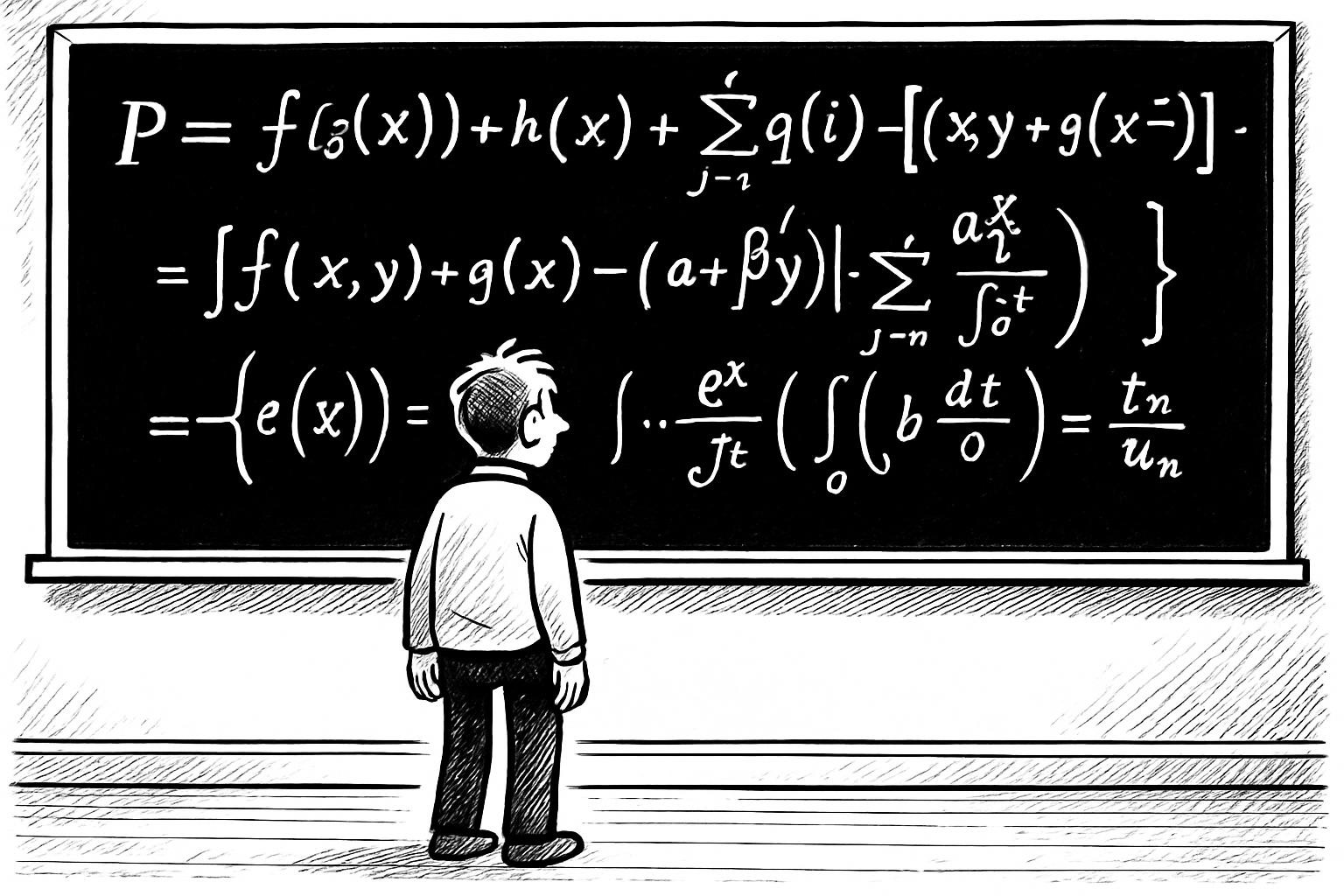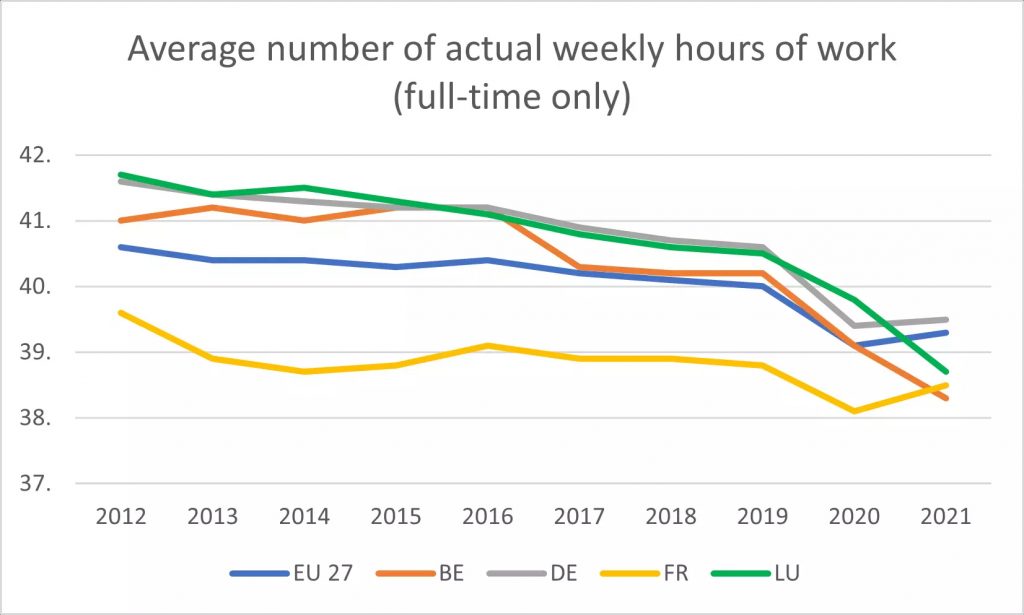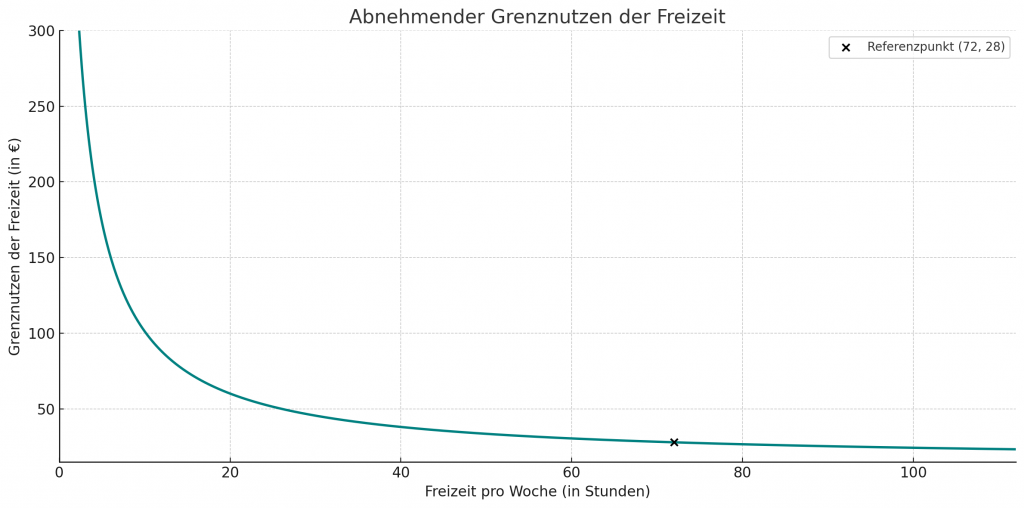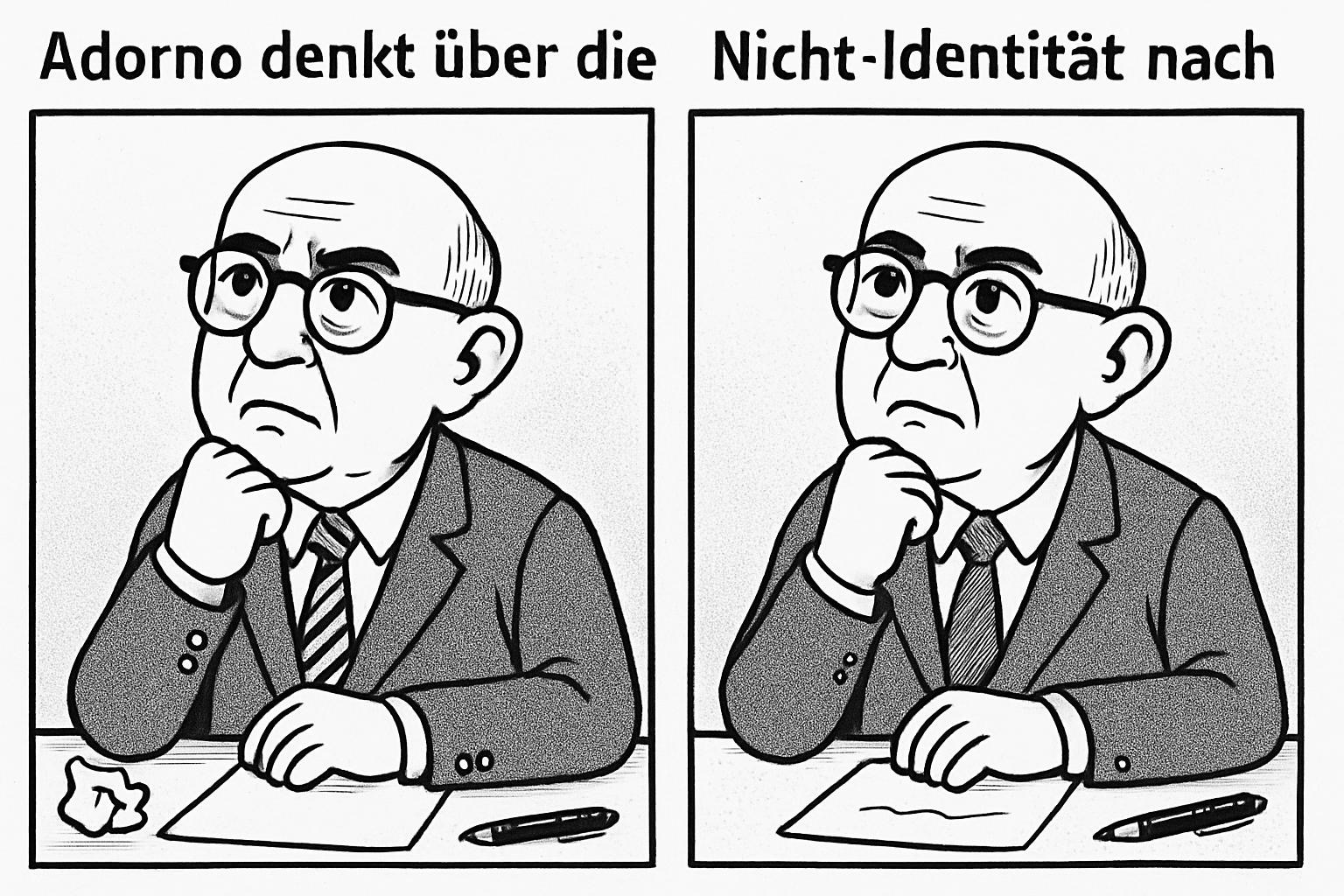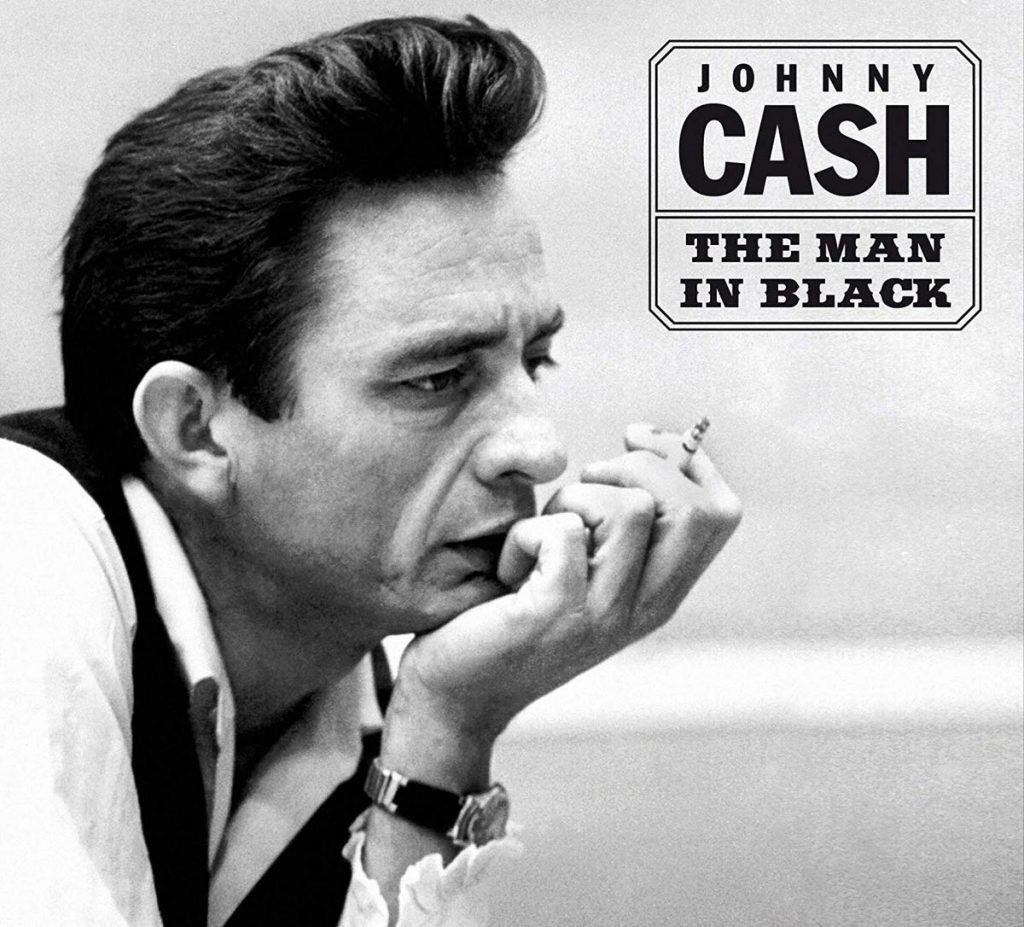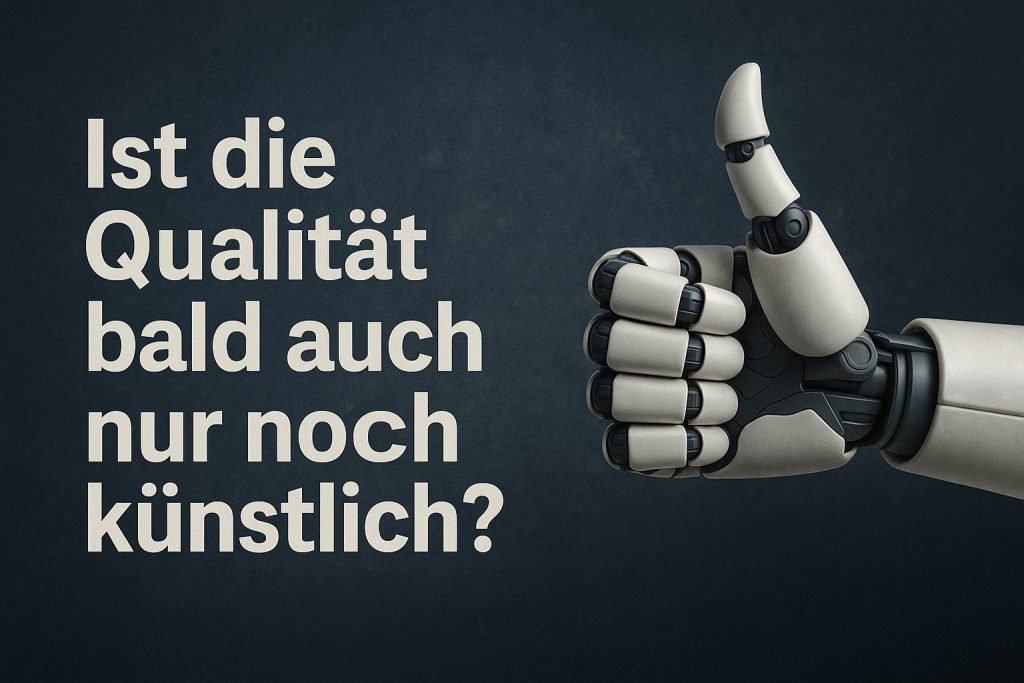Es wirkt wie politische Debatte, ist aber industriell hergestellte Erregung. Jan Fleischhauers Kolumne auf Focus Online
über das Bürgergeld ist ein Beispiel dafür, wie publizistische Formate nach den Gesetzen der Warenproduktion funktionieren: Der Text wird nicht geschrieben, um eine gemeinsame Wahrheit zu erarbeiten, sondern um ein Bedürfnis zu stimulieren, das das Medium selbst erzeugt – und daraus Ertrag zu schlagen.
Schon Adorno und Horkheimer beschrieben in der Dialektik der Aufklärung, dass in der Massenkultur jedes Werk so „zugeschnitten“ wird, dass es reibungslos konsumierbar bleibt. „Was nicht in die Standardisierung passt, wird von der Industrie aussortiert. Das Zufällige, das Störende, das Ungefügige ist der Kalkulation entzogen.“
Der Effekt ist planbar: Alles, was echten Austausch anregen könnte – Mehrdeutigkeit, Bruch, Offenheit – wird entfernt. Übrig bleibt ein Produkt, das sich mühelos teilen, empören und monetarisieren lässt.
Der dramaturgische Baukasten
Fleischhauers Text folgt einer klaren Sequenz:
1. Der Aufreger – eine scharfe Zahl mit moralischem Unterton: „Jeder zweite Bürgergeldempfänger besitzt keinen deutschen Pass.“
2. Die Szene – eine Miniatur wie auf einer Bühne: Ein Mann, eine Frau im Hijab, der Bewerbungsbutton der Bundesagentur. Das ist keine neutrale Beschreibung, sondern das gezielte Setzen von Symbolen, die im kollektiven Gedächtnis bestimmte Assoziationen auslösen.
3. Die Eskalation – Zahlen zu Kostensteigerungen, pointiert und isoliert präsentiert, bis ein Gefühl der Bedrohung entsteht.
4. Das Feindbild – Regierung, Verwaltung, SPD, „Bürgergeld-Advokaten“ klar umrissen als Gegenseite.
5. Der Untergangsverweis – historische Analogien, implizite Warnungen vor dem Zerfall staatlicher Ordnung.
Diese Struktur ist nicht der Erzählfluss einer offenen Debatte, sondern das „immer Gleiche“: eine wiederholbare, formalisierte Abfolge, die einen verlässlichen Affekt erzeugt – Empörung.
Vom Diskurs zum Produkt
Ein herrschaftsfreier Dialog, so wie Habermas ihn beschreibt, setzt Gegenseitigkeit voraus: Jeder muss seine Position begründen, Gegenargumente haben Platz. Fleischhauers Text bietet das Gegenteil: selektive Auswahl von Fakten, Ausschluss abweichender Perspektiven, Personalisierung komplexer Prozesse. Der Leser wird nicht eingeladen, mitzudenken, sondern eingenordet.
Der Zweck liegt im Geschäftsmodell von Focus Online und Burda: Klicks sind Währung, Empörung ist Rohstoff. Der Text ist ein Content-Baustein in einer Aufmerksamkeitsökonomie, die nach denselben Prinzipien funktioniert wie jede industrielle Massenproduktion: Wiederholung, Standardisierung, maximale Anschlussfähigkeit für den nächsten Erregungszyklus.
Die Kommerzialisierung des Konflikts
Was hier verkauft wird, ist nicht Erkenntnis, sondern Haltung. Der Leser soll sich bestätigt fühlen – oder empören. Beides steigert die Verweildauer, triggert das Teilen in sozialen Netzwerken und damit den Anzeigenwert.
• Affektmobilisierung: Wut bindet stärker als Nüchternheit.
• Identitätsangebot: „Wir, die sehen, was wirklich los ist“ – ein Wir-Gefühl gegen „die da oben“.
• Reproduzierbarkeit: Das Feindbild-Set – Ausländer, Kosten, Politikversagen – kann endlos variiert werden.
Herbert Marcuse hat diesen Mechanismus einmal als „Entpolitisierung durch Konsumierbarkeit“ beschrieben: Konflikte werden auf einfache kulturelle Gegensätze reduziert. So werden sie konsumierbar – und gerade dadurch unschädlich für die Machtstrukturen, die sie zu hinterfragen vorgeben.
Demokratie als Kulisse
Die Demokratie erscheint in dieser Inszenierung nur als Hintergrundrequisite: Sie liefert Themen und Skandale, nicht Ziele oder Lösungswege. Der Text kanalisiert Unzufriedenheit in eine ritualisierte Empörung, die in der nächsten Woche durch eine neue ersetzt wird. Die Energie, die in politisches Handeln fließen könnte, wird im Klick-Kreislauf verbrannt.
Das ist kein Unfall, sondern System: Wer den Mechanismus durchbricht, gefährdet das Geschäftsmodell. Deshalb ist die Wiederholung so treu, die Form so vorhersehbar, der Feind so zuverlässig.
Politik wird zur Serie – und der Leser zum Abonnenten eines Dauererregungsangebots, das mit öffentlicher Aufklärung ungefähr so viel zu tun hat wie ein Werbeprospekt mit kritischem Journalismus.