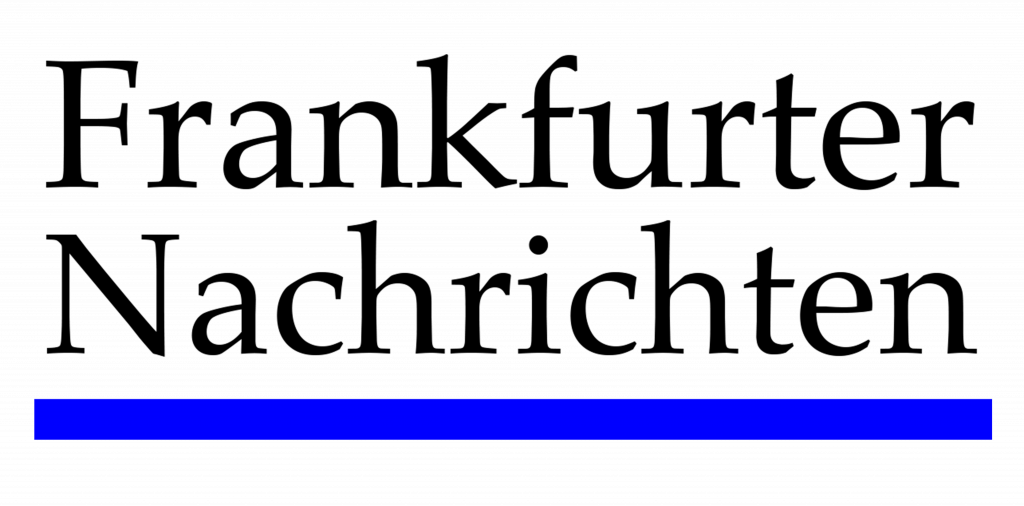Ein Essay über das Marktversagen, die Sehnsucht nach Eigentum – und den leisen Tod des Gemeinsinns
von Carsten Prueser
Die Statistik kennt keine Gemütlichkeit. Während in den Schaufenstern der Makler „Wohnträume“ versprochen werden, rutschen immer mehr Haushalte in jene stille Schockstarre, in der sich die monatliche Last der Miete wie eine zusätzliche Wand im eigenen Wohnzimmer anfühlt. Der Mietmarkt weist Symptome auf, die selbst liberalen Ökonomen das Wort „Versagen“ entlocken: Angebotsknappheit trotz Rekordbestand, Preise, die sich von den Löhnen entkoppeln, Immobilienkonzerne, deren Gewinne wachsen, obwohl der Kran auf vielen Baustellen stillsteht. Das Seltsame daran: All die Kurven, Kennziffern und Fondsberichte wirken plötzlich wie Rauchschwaden, sobald man mit Mietenden spricht – sie klagen nicht über Prozentpunkte, sondern über das Gefühl, aus der eigenen Stadt hinausgedrängt zu werden.
Doch jenseits der Mietmarktkrise gärt ein zweites, weniger beleuchtetes Drama: das deutsche Modell des Eigenheims. Lange galt es als republikanischer Mythos – solide, sparsam, sittlich. In der Nachkriegszeit wuchsen damit nicht nur Siedlungen, sondern auch Lebensentwürfe, die das Private zum höchsten Glück erklärten. Heute jedoch steht das freistehende Haus am Stadtrand sinnbildlich für eine Ökonomie, die Wohlstand in Quadratmetern misst und über die sozialen Kosten nur in Nebensätzen spricht.
Geld friert den Platz am Gartenzaun ein
Wer Eigentum erwirbt, braucht Kapital – wer Kapital einsetzt, erwartet Rendite. So verschiebt sich die innere Logik der Nachbarschaft: Der Gartenzaun markiert nicht mehr bloß ein freundliches „Bis hierhin und nicht weiter“, sondern wird zur dünnen Linie, jenseits derer jeder Satz über die Abwassergebühr oder den Busfahrplan sofort als Eingriff in den privaten Vermögenswert gelesen wird. Man hüpft nicht mehr zur spontanen Grillrunde hinüber, man verhandelt Nutzungsrechte. Man denkt in Verkehrswertsteigerung, nicht in gemeinsamem Spielplatz.
Das mag zugespitzt klingen, doch Zersiedelung ist keine rein geographische Kategorie – sie zersiedelt auch das Miteinander. Je weiter die Häuser auseinanderstehen, desto seltener die zufällige Begegnung, desto häufiger das Auto, das das Halböffentliche ersetzt. In der Summe verteuert das Modell Eigenheim die Infrastruktur, verdoppelt den Energieaufwand pro Kopf und isoliert die Menschen in ihren „Investments“. Sie nennen es Sicherheit – doch oft bedeutet es nur, dass die Angst ums Vermögen jede politische Idee verdächtig erscheinen lässt, die den Bodenpreis auch nur infrage stellt.
Neoliberale Sehnsucht nach den letzten Zäunen
Die 1990er Jahre haben dieses Modell auf die Spitze getrieben. Die große Privatisierungswelle verkaufte kommunale Wohnungen und versprach, der Markt werde das schon regeln. Das Ergebnis: Boden wurde zur Wertanlage, nicht zur Grundlage des Lebens. Die Finanzkrise 2008 tat ihr Übriges; seitdem fließt Geld, das keine Rendite mehr in Industrie oder Technologie findet, in Betongold. Der Traum vom Eigenheim verwandelte sich in ein globales Finanzprodukt – gehätschelt von Steuervorteilen, hypothekarisch befeuert, politisch verhätschelt.
Doch wo Märkte versagen, schützen sie plötzlich nicht mehr die Eigenverantwortung des Einzelnen, sondern nur das Eigentumsprivileg. Wer heute Hausbesitzer*in ist, verteidigt unbewusst eine Ordnung, in der „mein Grund“ wichtiger scheint als „unser Grundsatz“. Dabei riecht die Gegenwart längst nach Umbruch: Städte, die kaum noch Lehrerinnen und Pfleger anziehen können; Kommunen, die ihre Flächenziele beim Klimaschutz verfehlen; junge Familien, die den Kredit für die Doppelhaushälfte eher als Drohung denn als Traum empfinden.
Öffentliche Häuser, öffentliche Hoffnungen
Es flackern Alternativen auf. Wien zeigt mit seinem gigantischen Bestand an Gemeindebauten, wie sich Mieten halbieren lassen, ohne dass Lebensqualität schrumpft. In Deutschland erfinden Genossenschaften und Syndikate neue Eigentumsformen, bei denen Häuser dem Markt entzogen werden – unverkäuflich, nicht vererbbar, dafür dauerhaft leistbar. Jede solche Initiative ist weniger kühne Utopie als Erinnerung daran, dass Wohnen ursprünglich Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge war, keine Excel-Kategorie für Pensionsfonds.
Mag sein, dass die Rückkehr des Staates in die Baupolitik manchen nach Planwirtschaft riecht. Doch wer die Kosten externalisiert – Landfraß, Pendel-CO₂, zerbröselnde Innenstädte –, hat bereits eine versteckte Planwirtschaft, nur eben zugunsten des Privateigentums. Die überfällige Frage lautet: Was ist uns wichtiger – das Versprechen steigender Bodenrenditen oder das Versprechen einer Stadt, in der man sich ohne Terminkalender begegnet?
Ein anderer Begriff von Wohlstand
Vielleicht endet der Neoliberalismus nicht in einer großen ideologischen Explosion, sondern im leiseren Eingeständnis, dass Glück sich nicht in Portfolio-Apps messen lässt. Dann wird das Gespräch über Wohnen wieder zu einem Gespräch über Zeit, über Nähe, über das Recht auf Überraschung im Alltag. Es wird darum gehen, ob die Kinder auf der Straße Murmeln tauschen dürfen, statt sich in umzäunten Vorgärten zu verstecken; ob ältere Menschen auf einer Bank sitzen, die nicht der Rendite, sondern der Redseligkeit dient.
Und wenn irgendwann wieder ein Maklerfenster lockt, mag man sich erinnern: Ein Zuhause ist kein Anteilsschein, und ein Quartier ist kein Termingeschäft. Die eigentliche Dividende des Wohnens war immer der Blick in das Gesicht des anderen – und der leise Gedanke, dass wir an diesem Ort nicht Besucher, sondern Mitbewohner der Wirklichkeit sind.